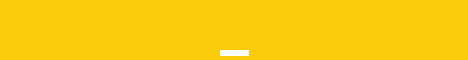Where is the Place to be? Das war einer der Fragen, die auf den Lokalrundfunktagen 2024 auf einem Panel über Audio-Plattformen am 25. Juni in Nürnberg diskutiert wurde: Wo und wie werden die Menschen in Zukunft Audio-Angebote konsumieren? Philip Artelt war dabei und hat die Debatte verfolgt.

UKW, DAB und… ja was eigentlich? Der dritte Ausspielweg für lineares Radio über IP ist eigentlich nicht mit den anderen beiden Wegen vergleichbar. Während die terrestrische Ausstrahlung auf weitgehende Einwegekommunikation vom Sender zum Hörer setzt, während die herkömmlichen Ausspielwege erstmal immer gleich funktionieren, ist das bei IP viel komplizierter. Die Kommunikation funktioniert auf einmal in beide Richtungen, der Rückkanal vom Empfänger zum Sender ist quasi schon gratis mit dabei. Und große Unternehmen, sogenannte Gatekeeper wie Amazon oder TuneIn, kontrollieren, was auf den digitalen Plattformen läuft.
„Der Smartspeaker hat das Küchenradio ersetzt“, konstatiert Andrea Heidrich von der österreichischen RIG Radio Innovations, „und im öffentlichen Raum sind wir bei der Generation Earphone angekommen.“ Die digitalen Ausspielwege – digital schließt dabei explizit nicht DAB+ mit ein – sind eine Herausforderung für die Sender.

Amazon beispielsweise, die für ihre smarten Alexa-Geräte das Radio Skills Kit (RSK) anbieten. Damit können Radiosender Streams hinterlegen, die dann über bestimmte Schlüsselwörter über Alexa Smart Lautsprecher aufgerufen werden können. „Wir kämpfen damit, dass diese momentan regelmäßig gelöscht werden“, erzählt Till Coenen von Radio Arabella aus dem Arbeitsalltag. Damit würden die Sender kurzfristig quasi von den Geräten verschwinden. Das zeige einmal mehr, wie dramatisch die Abhängigkeit von Gatekeepern wie Amazon sei.

Alexa und der Streamaggregator TuneIn liegen außerhalb der Kontrolle der Sender. Andrea Heinrich spricht auch deshalb davon, Aggregatoren zu verdrängen und durch einen eigenen „Radioplayer“ zu ersetzen, an dem sich private wie öffentlich-rechtliche Stationen gleichermaßen beteiligen.
In Österreich zum Beispiel ist der öffentlich-rechtliche ORF inzwischen bei der Radioplayer-Initiative mit eingestiegen, die ursprünglich nur von privaten Unternehmen vorangetrieben wurde. Gerade für die Privaten hat die Plattform zudem den Vorteil, dass nicht Werbeeinblendungen der Aggregatoren das Programm stören, von deren Einnahmen die Sender im Normalfall nichts abbekommen.

Bei dem Thema spielt auch Regulierung eine Rolle. So sind Sender über mehrere Verbreitungswege auch in Autoradios auffindbar. Dort reguliert der Medienstaatsvertrag, dass die Sender diskriminierungsfrei aufrufbar sind.
Die Autohersteller hätten sich zunächst gewundert, als die Medienregulierer auf sie zugekommen seien, sagt Annette Schumacher von der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM), der regionalen Aufsichtsbehörde über die Privatsender. Aber die Firmen hätten ein Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig Radio für unsere Demokratie ist. „Ich glaube, so ein BMW hat da einen Aha-Effekt gehabt“, freut sich Schumacher heute über die gute Kooperation mit den Autobauern.
Welche Plattformen sind entscheidend für die Zukunft des Radios?
Allerdings kann und muss man auch nicht jede Plattform bedienen. Till Coenen erzählt von Experimenten mit SmartTV im Radiobereich. Es sei schwierig, die Nutzer dazu zu bringen, Apps auf den Fernsehgeräten zu installieren, berichtet er. Zudem sei die Vielzahl der Plattformen von Tizen über AppleTV bis AndroidTV eine Herausforderung. Für jede müssen Apps angepasst oder neuprogrammiert und später auch aktuell gehalten werden, das kostet Zeit und Geld.

Die neuen Ausspielwege machen Kopfzerbrechen, bieten aber auch Chancen. Der erwähnte Rückkanal zum Beispiel, über den die Radiosender Informationen über Zielgruppe und Hörgewohnheiten bekommen können, eine permanente Media Analyse sozusagen. Das DTS Autostage System, das Till Coenen mit den Sendern Arabella und 95,5 Charivari in Zusammenarbeit mit der BLM testen konnte, soll diese Vorteile auch auf andere Übertragungswege ausweiten, wenn auch bisher nur im Auto.
Das System stellt einen Rückkanal zur Verfügung, in dem auch Analysedaten über den UKW- und DAB-Konsum der Autofahrer übertragen werden. Wer hört was, wann, wo? Coenen zeigt eine Landkarte mit einer Heatmap, einer Übersicht, wo die Sender besonders viel gehört wurden. Er zeigt auch eine Statistik, die Aufschluss über den Tagesverlauf der Einschaltquoten liefert. Während eines Fußballspiels ging die Nutzung runter, danach wieder rauf – da sind die Menschen vielleicht vom Public Viewing wieder heimgefahren und haben auf der Fahrt das Radio eingeschaltet.
Noch Zukunftsmusik ist die Übertragung des Tune Out bei Musik, also wann die Menschen bei bestimmten Liedern weg- oder abschalten. „Das wird kommen“, sagt Coenen.

Jürg Bachmann, Präsident des Verbands Schweizer Privatradios, ist sich indes sicher: Auch bei einer immer stärkeren Nutzung von IP-basierten Angeboten werden die Menschen in Zukunft weiterhin Radio hören, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Radio und Hörern bleibt bestehen. Oder, um es ein bisschen weniger romantisch auszudrücken, die Bindung an die Marke des Lieblingssenders wird auch in Zukunft wichtig sein.